[Hier den aktuellen Facebook-Skandal einfügen]
Überraschend kommt dieser Skandal keineswegs, aber es ist eine gute Gelegenheit (wenn auch nicht die erste), grundsätzlich darüber nachzudenken, wie Journalisten auf die Dauerprobleme mit Facebook reagieren sollen. In diesem längeren Kommentar versuche ich, das Problem medienethisch zu beleuchten und mache einen Vorschlag zum Handeln.
1. Facebook ist schon lange eine Problemfirma
Im Jahr 2007 berichtete Heise und andere Nachrichtenseiten, dass das „Online-Sozialnetz Facebook“ dem Protest von 50.000 Nutzern nachgegeben habe. Man hatte nämlich begonnen, die Einkäufe von Nutzern auch außerhalb des Portals zu tracken und dann deren Freunden diese Einkäufe ungefragt mitzuteilen („Facebook Beacons“). Die Statements von damals kommen einem bekannt vor: Zuerst bestritt man das Verhalten, dann gab man es zu, stellte die Rechtsverletzung aber so dar, als sei es für die User praktisch. Erst nach einem Gerichtsprozess entschuldigte man sich bei den Usern und stellte auf Opt-In um. Facebook musste 9,5 Millionen Dollar zahlen. Und dann fand ein Sicherheitsforscher heraus, dass die Daten auch bei Deaktivierung des Features weiter gesammelt wurden.
Das war der Auftakt zu endlosen weiteren Skandalen. Wikipedia listet in einem Artikel fast hundert Kritikpunkte. Es gibt eine eigene Seite, die aufzählt, wieviel Tage seit dem letzten Skandal vergangen sind. Man lernt im Rückblick über Facebook folgendes: Facebook fördert Ungleichheit, gefährdet das freie Netz, vermeidet Steuern, hat ein Monopol, ist unsozial, intransparent, bewusst irreführend und verstößt gegen Gesetze, insbesondere natürlich beim Datenschutz. Lügen bis zum Gerichtsprozess – so geht das nun seit über zehn Jahren. Allein 2018 wurden wieder sechs große Verfahren gegen Facebook eröffnet. Wer hier kein System erkennt und den Entschuldigungen von Mark Zuckerberg Glauben schenkt, ist naiv.
Das ist die gesamtgesellschaftliche Bilanz. Aber auch das journalistische System ist von Facebook bedroht. Auf manchen Medienveranstaltungen traut man seinen Ohren nicht, wenn von Facebook als Innovationspartner gesprochen wird. Dabei ist der Konzern ein Disruptor und eine Gefahr für die Medienkonzerne. Wie eine Facebook-Öffentlichkeit aussieht, wenn Journalisten kein Gehör mehr finden, zeigten die maßgeblich über Facebook organisierten Vertreibungen der Rohingya in Myanmar. Und Zuckerbergs kürzliches Statement zu Fake-News und Wahlen zeigt, wie rücksichtslos Facebook mit unserer Demokratie umgeht, wenn sich daraus Profit schlagen lässt.
Sind das nicht genug Gründe, damit Privatpersonen oder sogar Unternehmen moralische Bedenken haben sollten? Ich würde sagen ja – aber für den Journalismus gelten nochmals strengere Umstände.
2. Journalismus unterliegt einem besonderen Anspruch
Ganz egal, ob ein Verlag eine Facebook-Seite betreut, ein einzelner Journalist sein berufliches Profil bei Facebook pflegt oder Kommunikation zwischen Kollegen oder Gesprächspartnern bei Whatsapp abläuft: Diese Abläufe sind weder rein privat noch rein wirtschaftlich, sondern gehören zu dem vom Gesetzgeber privilegierten Bereich der Presse. Dadurch haben wir Sonderrechte: Ermäßigter Steuersatz, Zeugnisverweigerungsrecht, Redaktionsgeheimnis, Künstlersozialkasse, Pressefreiheit, Auskunftsanspruch, Ausnahmen von der DSGVO. Und zwar deshalb, damit wir unsere Funktion als Mittel zur öffentlichen Meinungs- und Willensbildung wahrnehmen können. Das Verfassungsgericht sprach sogar davon, dass die Presse dieser Funktion „dient“. Dazu kommt ein ethischer Anspruch, den sowohl der selbstauferlegte Presserat wie auch das Selbstbild als Vierte Gewalt widerspiegelt.
Man kann entsprechend nicht nur persönlich oder ökonomisch bewerten, ob man mit Facebook klarkommt, sondern man muss als Journalist die Eignung für die journalistische Aufgabe im Blick halten.
Was die persönlichen Vorteile der Facebook-Dienste für Journalisten angeht, z.B. die Bequemlichkeit von Whatsapp, wird man wohl zwangsweise feststellen, dass sie in keinem Verhältnis zum Schaden stehen, den der Konzern gesellschaftlich verursacht. Eine Abwägung der ökonomischen Bedeutung für Medienhäuser ist weitaus schwieriger. Da stehen auf der einen Seite kurzfristiger Traffic, großzügige Förderungen, Werbemöglichkeiten und Reichweiten, aber auf der anderen Seite eine Markenbeschädigung und die Degradierung zu Content-Lieferanten bzw. Moderatoren.
Hinzu kommt, dass Journalisten die öffentliche Meinung in besonderem Maße prägen. Eine Entscheidung, welchen Dienst zum Beispiel ein bundesweiter Fernsehsender unterstützt, hat eine enorme Bedeutung für die Reputation des Dienstes. Der Journalist wird so Mitverantwortlicher des Schadens, den er selbst anprangert.
3. Die Informationspflicht als Ausnahme
Dieser Meinung sind mittlerweile auch viele Rezipienten, die insbesondere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Doppelmoral kritisieren: einerseits wird in den Berichten Kritik an Facebook geübt, andererseits der Konzern über Buttons und Diskussionsaufrufe gefördert. Die öffentlich-rechtlichen Sender antworten dann gerne wir folgt:
In Zeiten immer stärker werdender Konkurrenz will das ZDF nicht darauf warten, bis dem Internet zugeneigte Zuschauer Programmangebote von sich aus finden und auswählen. Es geht vielmehr darum, dorthin zu gehen, wo das potentielle Zielpublikum ist und an dieser Stelle Werbung in eigener Sache zu machen.
Tatsächlich sieht der Rundfunkstaatsvertrag vor, dass die Öffentlich-Rechtlichen Medien „allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht“. Dazu können – nach einem anderen Urteil – auch externe Social-Media-Plattformen zählen. (VG München, Urteil v. 27.10.2017 – M 26 K 16.5928).
Es gibt also auch eine Pflicht, bei Facebook Journalismus zu betreiben. Und ich denke, was für die Öffentlich-Rechtlichen Medien Pflicht ist, kann man auch den anderen Medien zugestehen.
4. Das Problem nicht ignorieren
Das sieht also nach einer Zwangslage aus: Finanzielle Gründe oder der journalistische Informationsauftrag drängen uns dazu, eine hochproblematische Plattform zu nutzen und indirekt zu finanzieren, die aus anderen Gründen aber unseren Interessen widerspricht.
Was ist also zu tun? Als erstes sollten Journalisten dieses Dilemma, in dem sie sich mit Facebook befinden, transparent gegenüber der Öffentlichkeit machen. Es muss klar werden, dass die naive Förderung von Facebook, Instagram und Whatsapp ein Fehler war. Man sollte diese Debatte insbesondere mit der eigenen Community führen, die sich oft in der gleichen Zwangslage befindet: Auch viele Leser und Leserinnen finden Facebook schwierig, aber wagen aus Angst vor Social-Media-Isolation den Ausstieg nicht.
Der zweite Schritt ist vielleicht am wichtigsten: Bestehende, unproblematische Plattformen mit seinem Angebot fördern und festigen und Facebook-Nutzer gezielt auf diese Plattformen umleiten. Für die einen könnten vergleichsweise wenig kritisierte Unternehmen wie Twitter oder Snapchat schon eine gute Lösung sein, für andere bietet das Fediverse die korrektere Alternative. Es ist ein Jammer, dass beispielsweise Mastodon noch immer von keiner einzigen deutschen Nachrichtenredaktion bespielt wird. Auch RSS und Newsletter sollten als bereits etablierte Alternativen erhalten werden. Natürlich werden diese Alternativen Facebook in der Reichweite kurzfristig nicht einholen. Es geht hier auch darum, Haltung zu zeigen. Noch besser wäre ein Gesamtkonzept, wie man alternative Dienste neben Facebook gezielt stärkt und Nutzer dahin umsiedelt. Das gilt ganz genauso für die Messenger-Nutzung des einzelnen Journalisten oder der einzelnen Journalistin: Wer mindestens unter einer Alternative wie Threema oder Signal erreichbar ist, fördert den Wandel und grenzt nicht mehr diejenigen aus, die aus guten Gründen alle Facebook-Dienste deinstalliert haben.
Dann muss aber auch die größere Debatte beginnen, wie der Journalismus sich und seine Leserinnen und Leser dauerhaft aus dieser Zwangslage befreien kann. Auch Googles Engagement auf dem Mediensektor muss transparent hinterfragt werden und dessen Monopolisierung zum strategischen Thema werden. Wie sollen die Plattformen in der demokratischen Gesellschaft der Zukunft aussehen?
5. Fazit
Facebook hat sich zu einem so problematischen Konzern entwickelt, dass es, gemessen an dem hohen journalistischen Anspruch und dem besonderen Auftrag der Presse, in der Gesellschaft längst nicht mehr geboten scheint, dessen Dienste zu nutzen. Ob Facebook aus unternehmerischer Sicht mehr Schaden oder Nutzen bringt, sollen die Verlage entscheiden, aber die Redaktion sollte eine klare Haltung in Sachen Facebook bei ihren Social-Media-Followern zeigen. Alle Einladungen zur fröhlichen Interaktion bei dem Dienst, alle Whatsapp-Bewerbungen, alle Like-Buttons und Instagram-Hinweise sind nach meinem Ermessen ein Verhalten von vorgestern. Eine Pflicht zur Grundversorgung mit Nachrichten kann angenommen werden, falls hier ein Publikum erreicht wird, das sich von den klassischen Journalismuskanälen bereits verabschiedet hat. Aber ein solcher Konsumraum für News-Deprivierte sollte in engen Grenzen und mit klarem Konzept gestaltet sein und auch entsprechend kommuniziert werden. Ähnliches gilt für die leidige Frage, ob Whatsapp bei Journalisten ethisch vertretbar ist: Eben nur wenn Alternativen wie Signal, Threema oder SMS nicht zur Verfügung stehen.
Jeder Verlag, jeder Journalist, jede öffentliche-rechtliche Redaktion, die mit möglicherweise guten Gründen auf Facebook, Instagram und Whatsapp nicht verzichten kann, sollte die Problematik transparent darstellen und mindestens eine unproblematische Alternative bewerben. Noch besser wäre ein Gesamtkonzept, wie man Alternativen neben Facebook gezielt aufbaut und Nutzer dahin umsiedelt. Um kurz zu träumen: Richtig schön wären Aktionen, bei denen Medienhäuser gemeinsam alternative Plattformen fördern, die dem Journalismus gut tun. Auch wenn für Journalisten oder Medienhäuser dadurch Mehraufwand entsteht, wird das journalistische System dadurch insgesamt gewinnen.
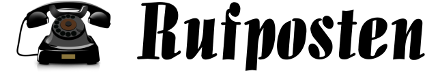

Hallo Herr Eberl,
mein Reden! Dann müssen einen aber auch Datenschützer in Cryptoparties nicht mit den Worten „Um whatsapp kommt man sowieso nicht herum“ abwimmeln! Und dann müssen Vereine die sich für den Datenschutz einsetzen nicht Anfragen zum Fediverse und Mastodon auf den St. Nimmerleinstag vertrösten! Wo sollen sich denn Ihrer Meinung nach dann User und Journalisten hinwenden wenn sie Fragen zum Fediverse, Mastodon und Co. haben?
Viele Grüße
Horst Meyer
Herr Meyer
wenn sie Fragen zum Fediverse, Mastodon und Co. haben
schauen sie doch mal bei
https://www.kuketz-blog.de/einstiegshilfe/
vorbei da wird alles erklärt und geholfen.
mfg
Hallo Herr Meyer. So etwas gibt es? Wozu denn verschlüsseln, wenn man WhatsApp und Co. nutzt?
Vielen Dank.
Aber ich möchte auch einmal einen Text lesen, der die Abwehrhaltung der Verlage gegen Facebook ökonomisch begründet.
Das ist doch klar, dass Verlage Facebook bekämpfen müssen weil Facebook Ihnen als gatekeeper den Zugang zur Aufmerksamkeit kontrolliert.
Zugleich fallen mir immer Texte auf, die völlig außer Acht lassen, welche soziale Leistung Facebook im positiven erbringt.
Ja klar, dann kann sich auch bei der Post für die vielen netten Briefe bedanken. Die soziale Leistung geht doch primär von den Mitgliedern aus und nicht von der Plattform. Was die Plattform für die Nutzer an technischer Leistung erbringt, ließe sich vermutlich mit einer mittelständischen Firma organisieren. Und übrigens, das wird oft vergessen: es gab bereits vor Facebook Lokalisten und StudiVZ. Facebook hat das nicht erfunden. Diese Mitbewerber wurden aber von Facebook plattgemacht – unter anderem, weil Facebook sich von Anfang an nicht an die Gesetze gehalten hat.
Das sehe ich nicht so. Die anderen haben schlicht kein Geld verdient. Der Netzwerkeffekt kommt hier natürlich sehr erschwerend hinzu
Das in dem Kommentar hier darunter verlinkte Rhein-Neckar-Blog macht übrigens eine ökonomische Rechnung: Dass das Moderieren der immergleichen Störer die gewonnene Reichweiter nicht wert ist.
Ein anderer Blog (RNB) hat vor Kurzem auch seine Facebook Präsenz geschlossen.
https://rheinneckarblog.de/18/gestartet-am-08-januar-2011-geloescht-am-19-oktober-2019/153016.html
Finde ich super. Die Einbindungen von Facebook hätte man dann aber konsequenterweise auch von der Seite nehmen sollen 😀
Hallo Herr Eberl,
ich habe dem Inhalt nach das gemacht, was Sie in Ihrem Blogpost veröffentlicht haben. Als Redaktionsleiter erkläre ich gegenüber unseren Leserinnen und Lesern, warum wir die FB-Seite geschlossen haben.
Nach meiner Kenntnis sind wir damit deutschlandweit als bekanntes Angebot Vorreiter.
Ihre Idee, dass die Branche sich gegenüber der Öffentlichkeit doch klar positionieren sollte, halte ich für fromm.
Die Branche hat darauf überhaupt nicht reagiert, weil die Sorge, irgendwelche Reichweiten zu verlieren, weitaus höher wiegt, als das eigene Handeln inhaltlich und verantwortlich zu hinterfragen.
Wir bauen an der Seite um, der FB-Button kommt auch noch weg.
Gruß
Hardy Prothmann
>ich habe dem Inhalt nach das gemacht, was Sie in Ihrem Blogpost veröffentlicht haben. Als Redaktionsleiter erkläre ich gegenüber unseren Leserinnen und Lesern, warum wir die FB-Seite geschlossen haben.
Sie gehen einfach hin,und verkünden die Universele Warheit.
Allein schon wie „Journalisten“ eienm immer erklären wollen,was Warh und Richtig ist.
Man kann Tora,Bibel oder Koran lesen,oder ne Deutsche Zeitung.
Hardy Prothmann,
Du bist kein Journalist. Du meinst zwar, Du wärst einer. Du bist aber mit Sicherheit keiner. Das ist ein Unterschied. Denk mal drüber nach.
Bastian Yotta meint auch, er wäre Unternehmer und Selfmademillionär. Ihr habt jedoch noch mehr gemeinsamkeiten: Andere verdienen an Eurem gekasperl und Ihr beide seid schon längst in der Bedeutungslosigkeit, wollt es aber selbst noch nicht wahrhaben.
Deswegen Firefox, wo jeder nach Hause telefonierender Facebook-Button oder Webpixel automatisch in einen Container gesperrt wird, aus dem er nicht raus kann. Da hat man dem Datensaugen schon einen guten (wenn auch nicht allumfassenden) Riegel vorgeschoben…
Hallo Sesa. Sich nur auf ein Add-on wie Facebook Container zu verlassen wäre trügerisch. Es funktioniert nur „innerhalb“ von Facebook. Einfach mal mit Tools wie „noscript“ überprüfen wieviel Quernfragen bei nur einem klick erzeugt werden. Auch sollte jeder für sich hinterfragen welchen Mehrwert Facebook wirklich bringt.
Natürlich wollen die Datenkraken abgreifen, was auch immer kommuniziert wird, um es weiterzuverkaufen, an Wenesauchimmerinteressiert: wie tief ist die economy (zu Deutsch: Wirtschaft) nur gesunken und bezahlt auch noch Unsummen dafür (die dann, natürlich, auf die Kunden umgelegt werden)?? Solange für Internetanbieter und deren Folgeprodukte (insbes. Werbebannereinblender) Milliarden an Gegenwert veranschlagt werden, stimmt irgend etwa nicht mehr in unserer Wertekalkulation.
Zum Thema Signal, Threema oder SMS: Signal ja, Threma fraglich sicher, SMS abhängig vom Standpunkt (also Netz, in dem gesendet/empfangen wird).
Freut mich wenn ihr von eurer eigenen Medizin (NetzDG, Zensur) schmecken müsst.
Hier ein Link zu einem hochinteressanen Bericht. In ihm wird veranschaulicht, wie einfach
GELD durch
FACEBOOK die
WELT REGIEREN kann.
Z.B. durch „Dark Posts“, die Donald Trump den Wahlsieg gebracht haben.
https://www.arte.tv/de/videos/082806-000-A/fake-america-great-again/
Hi Rebel,
danke für den Tip
Facebook!
Ja, die Praktiken bezüglich des Sicherlaubens von Facebook, beruht schon auf Dreistigkeit.
Ein massiver Dämpfer von Seiten der User/Nutzer wäre schon Vorteilhaft um die mittlerweile
hochnässigen Geschäftsleute mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu bugsieren. Immermehr
Geschäftsleute, so auch ich selbst betroffen, werden aufgrund scheinheiliger Beweggründe aus der Plattform ausgestossen aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen. Zumindest, gibt es keinerlei begründete nachvollziehbare Tatsachen, warum man ausgestossen wurde. Irgendwo habe es einen Fehler gegeben, „Ende aus, das war es ihr Konto bleibt dauerhaft gesperrt und kann nicht wieder hergestellt werden nach unserer Prüfung“. Man kann sich nicht verteidigen noch klären, warum weshalb was wurde falsch vom Unternehmen gemacht. Das ist eine Schmach!
Es sollte solche Unternehmen per Gesetz auferlegt werden einen telefonischen Support bieten zu müssen. Dieses Verhalten von Facebook bringt so manch ein Unternehmen in Bedrängnis, weil man sich hier deren Zielgruppen und schon längerfristige Kundschaft befindet.
Mir stellt sich die Frage, ob die im Beitrag genannten Lehren über FB ein individuelles Problem DIESES sozialen Netzwerks ist. Auch wenn man von anderen, sei es Twitter, Instagram et. al. keine solche Skandalgeschichte schreiben kann, stellt sich mir die Frage, ob die in Gestalt FBs dokumentierten „Spitzen“ nicht viel mehr ein grundlegendes strukturelles Problem ist.
Wenn ich etwa die Tweets der letzten Tage von Kai Diekmann sehe – ein Foto vom morgendlichen Blick aus dem Fenster etwa oder auch die „Nachricht“, was er am Morgen in der Post hatte, erkenne ich – Diekmann ist mit solchen Banalitäten in den SN ja nun in „allerbester Gesellschaft“ in dem Sinne, dass solche weltbewegenden Neuigkeiten alle Kanäle längst überflutet haben, zeigt sich doch, welcher menschliche Impuls das Fundament für „social media“ bildet und fördert: den „Tanz um die heilige Kuh“ des eigenen Egos.
Wenn aber dies der „Dreh- und Angelpunkt“ des Grundgedankens der social media bildet – pervertiert sich dann nicht der Begriff des Sozialen ins Unsoziale? Und sind dann nicht alle hier nur für FB aufgelisteten/erinnerten Verfehlungen des Unternehmens nachgerade eine „natürliche Folge“ aus dem Erfolg – von dem sich andere (wirtschaftliche nicht so dominante/erfolgreiceh) SN dann gewiss graduell unterscheiden lassen – strukturell aber nicht mehr.?
Addendum: Angst vor dem Ausstieg setzt den Einstieg voraus. Als die SN aufkamen, habe ich als technikaffiner Journalist gleich jeweils einen persönlichen Account bei FB und Twitter angelegt. Da kamen schließlich zwei netzbasierte Verbreitungskanäle rasant auf, und wenn man am Puls der Zeit bleiben wollte, schien man gut damit beraten, gespannt zu beobachten, was sich da entwickelt…
Dummerweise benötigte man für die Kenntnisnahme über bloße Snippets hinausgehende Einsicht häufig einen Login – immerhin war ich von vornherein vorsichtig genug, die dazu nötigen Accounts unter einem Pseudonym anzulegen und mich mit der Eingabe persönlicher Daten zurückzuhalten.
Ich weiß nun nicht einmal mehr, wie alt meine Accounts bei FB und Twitter inzwischen sind und ob ich bei Instagram überhaupt je einen angelegt habe – einzig Whatsapp habe ich mich beharrlich verweigert. Was ich aber genau weiß: Ich habe bis heute weder eine eigene FB-Site, noch habe ich je aktiv etwas getweetet – auch, weil ich die Erfolge meines morgendlichen Stuhlgangs für mich zwar als essentiell erlebe, in Relation zum übrigen Weltgeschehen indes für ziemlich irrelevant halte…
Wenn ich dagegen meine, der Öffentlichkeit Relevantes mitzuteilen zu haben – das kommt in meinem Beruf nun mal regelmäßig vor – habe ich es in den entsprechenden Medien meiner Arbeit- oder Auftraggeber natürlich getan. Und wenn die meinten, von mir gelieferte Inhalte auch außerhalb selbst herausgegebener Publikationen zusätzlich über die sozialen Medien zu verbreiten oder auch nur zu bewerben, hatte ich damit natürlich keinerlei Probleme. Aber dazu musste ich mich ja nicht eigener SM-Accounts bedienen…
Die heute als Überlebensvoraussetzung im Journalismus nachgerade zur Selbstverständlichkeit geronnene Überzeugung der Notwendigkeit des „Selbstmarketings“ ist für mich – auf den Journalismus bezogen – auch nur EIN Teil des in meinem vorangegangenen Postings herausgestellten „Salonfähigwerdung“ der Egomanie. Und wo die – nicht zwingend „bewusstseinspflichtig“ – zur Triebfeder wird, muss man sich über die Folgen im Privaten wie Geschäftlichen wie Öffentlichen doch nicht wundern.
Was habe ich nun wegen dieser persönlichen Auffassung in den vergangenen 15 Jahren verloren?
Hmm, ich weiß es nicht so wirklich. Was ich aber wirklich weiß: ich habe in dieser Zeit weitergelebt und das nicht einmal schlecht! Gefehlt hat mir nix – zumindest nix, das ich mit einer aktiven und intensiven Nutzung der SM hätte „heilen“ können.